
Stiftsruine der alten
Reichsabtei in
Bad Hersfeld |
Ich bin in Bad Hersfeld
geboren und auf dem Tageberg aufgewachsen. Während meiner gesamten
Schulzeit durchquerte ich täglich den ehemaligen Klosterbezirk mit
seiner großen romanischen Stiftsruine, hörte am
jährlichen Gründungsfest der über 1200 Jahre alten Stadt
die älteste noch funktionierende Glocke Deutschlands: Ihr Klang führt
direkt in die Epoche des salischen Königs, in der das
Reichskloster Hersfeld in Reichtum und im Ansehen seiner Bibliothek
durchaus mit Fulda konkurrieren konnte.
|
Der Klang der Glocke
erinnert zudem an das Leben eines Mönchs, der hier gelebt und
geschrieben hat: Lampert von Hersfeld. Seine Annalen stellen
die Hauptquelle zum Leben König Heinrichs IV. bis zu den Tagen von
Canossa dar.
Als Sohn einer traditionsbewußten Familie, deren Ursprünge
bis in das Hersfelder Mittelalter zurückreichen, und Schüler
der Alten Klosterschule wurde ich früh mit der Geschichte
der Stadt konfrontiert.
Während meiner
ersten Jahre im Gymnasium gelang es unserem Geschichtslehrer, uns den
trockenen Stoff der mittelalterlichen Herrscher auf eine ebenso simple
wie erfolgreiche Weise nahezubringen: Er erzählte
Geschichte, das heißt, er löste sie in Anekdoten mit ›human
touch‹ auf, in fesselnde Szenen, in denen sich pralles und buntes Leben
nachvollziehbar abspielte. Er betonte die Erlebnisperspektive der
handelnden Figuren, malte die schicksalhaften Begegnungen aus, stellte
die melodramatische Situation in den Vordergrund – und hatte unsere
Aufmerksamkeit gefangen. Unversehens war Geschichte nicht mehr eine
mühsam auswendig zu lernende Abfolge von Königen und Kaisern,
die meist Karl, Otto, Heinrich oder Friedrich hießen, nicht mehr
die Ansammlung abstrakter Begriffe wie Investiturstreit,
Wahlkönigtum, Lehnsrecht, Ministerialität: Geschichte
verwandelte sich in einen Kosmos konkreter, gefühlsintensiver und
abenteuerlich-fremder Geschichten, kurz: Geschichte wurde zum Roman.
Der »Gang nach
Canossa« ist in der deutschen Sprache ein stehender Begriff.
Sucht man nach materiell faßbaren Zeugnissen der Epoche, die
unter dem Stichwort »Investiturstreit« in die
Geschichtsbücher eingegangen ist, steht man, so man überhaupt
fündig wird, meist vor Ruinen wie der Hersfelder Stiftsruine. Man
findet den Dom zu Speyer mit den Gräbern der salischen Kaiser.
Mehrfach umgebaut und restauriert, stellt er das beeindruckendste
steinerne Zeugnis der damaligen Zeit in Deutschland dar.
Von der Harzburg stehen
nur noch Überreste, die viel Phantasie vom Betrachter erfordern.
Die Reichspfalz zu Goslar vermittelt dagegen ein anschaulicheres Bild
damaligen Residierens. Das Schlachtfeld an der Unstrut suchte ich
vergeblich. Nördlich von Bad Langensalza erstrecken sich Felder,
begrenzt von Baumreihen: Hier ist, wie bei so vielen anderen
Schlachtfeldern, das blutige Ereignis versunken, ohne materielle Spuren
vor Ort zu hinterlassen.

Die heutige Burgruine von
Canossa im Regen |
Während der
Planungsphase des Romans reiste ich auch zur Burg von Canossa, die sich
südlich von Reggio nell‘ Emilia im idyllischen Hügelland des
Apennin erhebt. Die Burg wurde seit dem 11. Jahrhundert mehrfach
zerstört, ein oder mehrere Erdrutsche haben zudem die Physiognomie
des Hügels stark verändert. Zurückgeblieben ist ein eher
kleiner Kegel mit Resten alter Mauern.
|
|
Als ich Canossa zum
ersten Mal abends um sieben Uhr erreichte, verschloß der
Wärter soeben den Eingang. Es herrschte trübes, regnerisches
Wetter; verloren studierte ich ein bescheidenes Erinnerungsschild der
Markgräfin Mathilde, das an einer ebenso bescheidenen Trattoria
angebracht war. Hinter mir langweilte sich ein leerer Parkplatz. In der
Ferne verschwammen weitere Burgen und Hügel im Dunst.
|
|

In der Burgruine von
Canossa |
Wenige Tage später
suchte ich Canossa erneut auf: Diesmal tagsüber, im Sonnenschein.
Als einziger Besucher schob ich mich durch die Ruinen, schaute in das
kleine Museum: Schwer nachvollziehbar, daß hier oben ein
welthistorisches Ereignis hatte stattfinden können. Ein
Jahrhundertwinter mit unendlichen Schneemassen und einem zugefrorenen
Po, wie er zweifelsfrei überliefert ist, war ebenfalls nur mit
Mühen auszumalen.
|
In der Ferne dieser
seltsame Tafelberg. Schafe weideten als kleine Punkte auf einer
saftigen Wiese, die Hügelidylle leuchtete im
Frühlingsgrün, und die Burg träumte in pastoraler
Umgebung vor sich hin.
Was an Canossa der Erosion der Zeit standgehalten hat, ist dennoch ein
treffendes, weil karges Zeichen der damaligen Epoche. Denn das
populäre, häufig bunte und wenig finstere Mittelalterbild,
das unsere Köpfe füllt, ist entstanden aus Quellen und
Zeugnissen des hohen, meist sogar späten Mittelalters und
läßt sich kaum auf die zweite Hälfte des 11.
Jahrhunderts übertragen. All das, woran wir in erster Linie denken
und was dieses Bild bestimmt, entwickelte sich damals erst aus
zaghaften Anfängen: Dies gilt für die über ganz Europa
verstreuten, meist im historisierenden 19. Jahrhundert grundlegend
restaurierten oder wieder aufgebauten Burgen; es gilt ebenso für
die pittoresk verwinkelten Städte. Auch die mittelalterlichen
Ritterspiele und Märkte, Filme und Romane mit Turnierkampf und
Minnesang, Kreuzritterfuror und Schwarzem Tod, mit blondgezopften
Burgfräulein und schwertschwingenden Tristan-Lancelots, mit
aufgeklärten Detektivmönchen und finsteren Hexenverfolgern
beziehen sich auf eine Zeit nach der revolutionären Epochenwende
des 11. Jahrhunderts. Selbst die vielfältigen religiösen
Bewegungen und Orden entwickelten sich nach der Anstoßepoche von
Cluny erst im 12. und 13. Jahrhundert.
Im 11. Jahrhundert duzte
man sich generell im deutschen Sprachraum bzw. im Latein der Kleriker;
Ausnahmen forderten Papst und König, die häufig den pluralis
majestatis benutzten und auch mit »Ihr« angeredet,
besser: angeschrieben wurden. Zu dieser Zeit fanden sich in
»Deutschland« (das Wort »deutsch« im heutigen
Sinn entwickelte sich damals erst) kaum Steinhäuser, abgesehen von
den alten Römerorten kaum Städte, die den Namen verdienten,
die Phase der Rodung und Urbarmachung hatte erst begonnen, Handel und
mit ihm Geldverkehr steckten in den Kinderschuhen. Es gab weder eine
überlieferte volkssprachliche Literatur noch ein ritterliches bzw.
»höfisches« Wertsystem, die Kleidung hatte sich seit
Jahrhunderten kaum geändert. Erst mit der
Bevölkerungsexplosion und der sozialen wie kulturellen
Dynamisierung des 12. Jahrhunderts strebte Mittel-, West- und
Südeuropa auf das literarisch so ungemein fruchtbare
»Hochmittelalter« zu, das sich dann in weiteren drei
Jahrhunderten ›spätmittelalterlich‹ entfaltete und die Grundlage
legte für die Neuzeit.
Das 11. Jahrhundert hat
uns, verglichen mit dem 13. bis 15. Jahrhundert, wenig Zeugnisse und
Quellen hinterlassen. Die Annalen und Berichte der damaligen Zeit sind
von Mönchen geschrieben, also aus einer spezifischen Sicht, der
das Interessse an Alltag und Alltäglichem völlig fehlt.
Geschichte war Heilsgeschichte: ein Bemühen um ›Objektivität‹
und ›Wirklichkeitsnähe‹ lag außerhalb des damaligen
Bewußtseins. So sind auch die zentralen Quellen über die
Ereignisse und die Personen, die in dem Roman eine Rolle spielen,
offenkundig voreingenommen, bis hin zu Lobeshymnen oder Verleumdungen.
Es nimmt daher nicht wunder, daß die Geschichtswissenschaft sich
über die Darstellung und Bewertung der zentralen Charaktere alles
andere als einig ist.
Für den Romancier
folgt daraus, daß er aus dem spärlichen und wenig objektiven
Material ein eigenes Bild entwerfen muß: die Wahrheit seiner
Geschichte.
Bei all dieser
Relativierung möchte ich betonen, daß der Roman Canossa
sich weitgehend an die historisch unstrittigen Daten hält,
selbstverständlich in einer dramaturgisch gebotenen Vereinfachung
der Personenzahl und der politischen Verwicklungen, in einer Zuspitzung
der Handlung sowie einer Ausmalung der Leerstellen.
Bis auf eine einzige sind
alle zentralen Personen des Romans historisch verbürgt. Die
jeweiligen Jahresdaten wurden im großen und ganzen eingehalten.
In die Reden, Dialoge und Gedanken sind zahlreiche wörtliche
Zitate, Bilder und Metaphern aus den mittelalterlichen Quellen
eingewoben. Sobald die Quellen konkret wurden, habe ich ihre Details
aufgegriffen (so zum Beispiel die Ereignisse in Kaiserswerth, Lamperts
Schilderung von der winterlichen Überwindung des Passes am Mont
Cenis, der Cencius-Überfall auf den Papst während der Messe,
die Art und Weise, wie Gottfried der Bucklige zu Tode kam und viele
andere). Bei den zahlreichen fragwürdigen Berichten habe ich
versucht, zwischen der mir vorstellbaren historischen Wahrheit und den
Erfordernissen der Romanhandlung einen Weg zu finden. Dies gilt
für die angeblichen sexuellen Ausschweifungen des jungen Heinrich
wie für die angeblichen Bettgeschichten des Papstes.
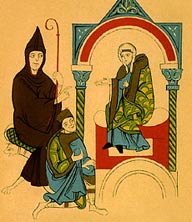
|
Heinrich IV. erlitt ein
extremes Schicksal und hatte sein Leben lang zu kämpfen: Daher
schwankt sein Charakterbild in der Geschichte wie in der
Geschichtswissenschaft – bis heute. In meinen Augen ist er ein eher
positiver, allerdings tragischer Held, und entsprechend habe ich ihn zu
zeichnen versucht.
Sein Gegenspieler, Papst Gregor, der »heilige Satan«, wird
selbst von seinen Anhängern skeptisch gesehen: Man attestiert ihm
ein nahezu alttestamentarisches Sendungsbewußtsein, gleichzeitig
Herrschsucht, sture Rechthaberei bei gleichzeitiger Neigung zu
sentimentalen Tränenausbrüchen.
|
Insbesondere Mathilde
wird nicht nur als attraktiv, klug und zupackend, sondern auch als
hochfahrend und berechnend geschildert. Was Lampert angeht, so war
seine Einstellung zu Heinrich, wie den offiziellen Annalen
unmißverständlich zu entnehmen ist, nicht so positiv wie in
den geheimen Annalen, die erst jetzt der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
Der historische Roman
lebt davon, daß er anschaulich und fesselnd zeigen soll, wie das
Leben vergangener Zeiten war und, darüber hinaus, wie es gewesen
sein könnte. Je nach Überlieferung, Dramatik historischer
Abläufe und erzählerischer Absicht zielt man als Autor mehr
auf Authentizität oder mehr auf Ausschmückung. Selbst der
streng wissenschaftliche Historiker kommt ohne deutende Phantasie nicht
aus; für den Romancier ist sie ein Muß, denn er will das
Bekannte, Vermutete und Vorstellbare nach den Gesetzen einer in sich
stimmigen, menschlich anrührenden, dramatisch zugespitzten, kurz:
spannenden und überzeugenden Geschichte gestalten.
Die Vermittlung einer so
fernen Zeit wie des mittelalterlichen 11. Jahrhunderts, in der das
Lebensgefühl sich stark von dem heutigem unterschied, stellt den
schwierigen Versuch dar, eine (schwankende) Brücke zu schlagen
zwischen dem Fremden und dem uns Naheliegenden, zwischen der Sprache
der Quellen, der wissenschaftlichen Rekonstruktion der vergangenen
Mentalität und dem heutigen Lebensgefühl, den heutigen
Deutungsmustern und emotionalen Reaktionen. Da wir über den Alltag
wie über das Gefühlsleben wenig Gesichertes wissen, gar nicht
zu reden von dem Unausgesprochenen (oder ›Unbewußten‹), die
Darstellung ›runder‹ Charaktere jedoch die Vermittlung
zeitgemäßer psychologischer Denkmuster verlangt, wird man
als Romancier von einer Hypothese des ›Allgemein-Menschlichen‹
ausgehen: Auch damals haben sich die Menschen einsam gefühlt, sich
sterblich verliebt, brachten Opfer, zitterten vor Angst.
Darüber hinaus ist anzunehmen, daß sie sich impulsiver
verhielten als die Menschen heute. Ihr Denken war uneingeschränkt
von christlichen Selbstverständlichkeiten bestimmt und zugleich
›magisch‹ oder abergläubisch. Sie sahen überall
göttliche Zeichen, fürchteten Verwünschungen, das
geheimnisvolle Wirken böser Mächte und die ewige Verdammnis
in der Hölle; zugleich suchten sie ihr jenseitiges Heil. Ich habe
versucht, diesen Aspekt des Denkens und Fühlens deutlich zu machen.
|
Das Verhältnis von
(persönlicher) Treue und Verrat war konstituierend für die
›politischen‹ wie allgemein zwischenmenschlichen Beziehungen. Da
Heinrich IV. sein Leben lang unter Verrat leiden mußte, spielt
dieses Thema eine zentrale Rolle in dem Roman. Betrachtet man sein
Verhältnis zu den Fürsten und wirft gleichzeitig einen Blick
auf heutige Berichte aus Ländern mit archaischeren sozialen wie
politischen Strukturen, so kann man manche Vergleiche ziehen. In diesem
Sinne gehört das Widerspiel von Treue und Verrat zum
›Allgemein-Menschlichen‹, zum Grundbestand der conditio humana.
|
|
Hinweise zur Literatur
Ein Wort noch zu den
Quellen und zu der Literatur, die ich benützt habe. Einen auch nur
annähernd vollständigen Blick auf die verwendete Literatur zu
geben, würde zu einer seitenlangen Literaturliste führen, was
nicht Sinn eines Romannachwortes sein kann. Hinweisen möchte ich
dennoch auf die verwendeten Quellensammlungen der Freiherr von
Stein-Gedächtnisausgabe: Darunter natürlich Lampert von
Hersfelds Annalen, die Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrichs
IV., die weitere Lebensberichte sowie seine Briefe enthalten, die
beiden Bände zum Investiturstreit, in denen die Korrespondenz
Gregors VII. und Streitschriften gesammelt sind. Andere Quellen wie
Adam von Bremens Gesta wurden herangezogen sowie die soeben
erschienenen Quellen zur Alltagsgeschichte im Früh- und
Hochmittelalter.
Eine Aufsatzsammlung zu Canossa
als Wende erschien bereits vor gut zwei Jahrzehnten in der
Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Über das Leben Heinrichs IV.
informiert Ernst W. Wies in seiner Biographie, über Mathilde Paolo
Golinelli in seinem Buch Mathilde und der Gang nach Canossa
sowie Vito Fumagalli. Über Gregor VII. erschien kürzlich eine
Monographie von Uta-Renate Blumenthal. Werner Goez schreibt in seinen Gestalten
des Hochmittelalters anschaulich über ihn wie über
Mathilde und Benno von Osnabrück. Die Aufsatzsammlung von Horst
Fuhrmann: Einladung ins Mittelalter enthält eine Menge
nützlicher Informationen. Lebendig liest sich S. Fischer-Fabians Die
deutschen Kaiser. Grundlegend zu der Salierdynastie ist Egon
Boshofs Die Salier sowie Stefan Weinfurters Herrschaft und
Reich der Salier. Der Katalog zur großen Salierausstellung in
Mainz (1992, Das Reich der Salier) und mit ihm die von Stefan
Weinfurter herausgegebene Buchreihe Die Salier und das Reich
stellen ebenfalls zahlreiche nützliche Informationen zusammen und
beleuchten wichtige Aspekte der Epoche.
Da die Forschungen zur
Alltagsgeschichte während der letzten Jahrzehnte im Vordergrund
der Forschung standen, habe ich eine ganze Reihe von Werken heranziehen
können. Wie bereits angedeutet, beziehen sie sich in der
Hauptsache auf das Hoch- und Spätmittelalter ab 1150 und streifen
nur das 11. Jahrhundert. Zu nennen sind Peter Dinzelbacher (Europa
im Hochmittelalter 1050 – 1250), Ernst Schubert (Alltag im
Mittelalter), Hans-Werner Goetz (Leben im Mittelalter), Vito
Fumagalli (Wenn der Himmel sich verdunkelt), Joachim Bumke (Höfische
Kultur), Otto Borst (Alltagsleben im Mittelalter) sowie die
Standardwerke von Arno Borst und Jacques Le Goff. Nicht aufgezählt
werden können die Lexika und Darstellungen zur Geschichte der
Mode, zum Reisen, zum Leben der Bauern und Frauen, der Vaganten und
Mönche, zum religiösen Leben, zu den Eßgewohnheiten, zu
Krankheiten und Katastrophen usw. Hervorzuheben ist aber noch neben der
Bibel und älteren
Messe-Brevieren das neunbändige absolut unverzichtbare Lexikon
des Mittelalters, das mittlerweile als Paperback-Ausgabe bei dtv
vorliegt und zu allen Themen die wichtigsten Informationen bereitstellt.