Zwar war ich mit der
Geschichte der Farnese-Familie, über
die ich mittlerweile zwei Romane geschrieben habe, vertraut und wusste,
dass
die Villa ursprünglich von Agostino Chigi, Roms bedeutendstem banchiere der Hochrenaissance, gebaut
worden war und erst um 1580 in die Hände des Gran
Cardinale Alessandro Farnese überging, doch erst Sandro
Pignatti, mein vielseitig gebildeter Führer, machte mich anregend
und
anekdotenreich mit der Geschichte dieser einzigartigen Villa, ihrer
Architektur
und dem Hintergrund ihrer atemberaubenden Fresken vertraut.
Betritt man von der
Via della Lungara den Park der
Farnesina, macht die (in der Renaissance bemalte) Eingangsfassade der
Villa
einen eher strengen Eindruck. Ihre architektonische Faszination
entfaltet erst
die Gartenfront mit den beiden Seitenflügeln, dem erhöhten,
säulengestützten
Eingangsbereich, der direkt in die Loggia di Psiche führt.

Die
Faszination
verstärkt sich, spaziert man durch die großen Räumen
der Villa. Die
Sinnlichkeit und Lebendigkeit ihrer mythologisch und
lebensgeschichtlich
inspirierten Fresken, ihre verspielte Vielfalt und unbekümmerte
Detailfreude
sowie ihr Verweisungsreichtum lassen den Betrachter dieses
Renaissance-Juwels
erst einmal in schweigendes Staunen fallen.


Raffael: Triumph der Galathea
Raffael:
Die
drei Grazien
(der
Rückenakt soll Imperia darstellen)
Doch der
kunsthistorische Hintergrund mit seinen
unterschiedlichen Deutungs-möglichkeiten
gewinnt
erst
–
und
natürlich
ganz
besonders für einen Romancier –
seine
Faszinationskraft durch die Geschichten, auf die er verweist und die er
vermittelt. Es sind nicht nur die Anekdoten über die
Künstler, welche die Villa
ausgeschmückt haben, unter ihnen insbesondere Raffael und
Sebastiano del Piombo
(ursprünglich Luciani), sondern in erster Linie die Geschichten,
die sich um
den Bauherrn Agostino Chigi und seine beiden Geliebten Imperia und
Francesca
drehen. (Von allen dreien gibt es leider keine gesicherten Abbildungen.
|
Diese Geschichten sind
in sich
bereits romanhaft und enthalten alle Ingredienzien ergreifender
Schicksale: Ein
›mittelständischer‹, noch junger banchiere aus
Siena geht nach Rom, um
dort Karriere zu machen und reich zu werden,
und steigt durch ökonomisches Geschick und Glück, durch
Charme und geschickte
‚Vernetzung’ rasch zum vermögendsten Mann der Ewigen Stadt, wenn
nicht ganz
Italiens auf. Er ist aber kein Onkel Dagobert, der geizig seine
goldglänzenden
Dukaten hortet, sondern ein früher global
player, der geschickt investiert und die ökonomischen Gesetze
des
Frühkapitalismus auszunutzen versteht, und zugleich – als
typischer
Renaissancemensch – ein hochgebildeter und generöser Liebhaber
aller schönen
Künste, inclusive der Liebeskünste.
|
Während seines
Aufstiegs unter dem Pontifikat von Julius II.
beherrscht Imperia, die Kaiserin der
Kurtisanen, das Reich römischer
Edelprostitution. 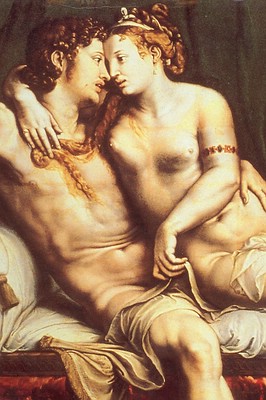 Zu ihren
Verehrern zählen die intellektuellen
Koryphäen Roms,
die Spitzen des Vatikans und auch der römische Geldadel, in
vorderster Linie
Agostino Chigi. Zahlreiche Verehrer preisen sie in ihren Gedichten und
Novellen
– und zeigen sich schockiert, entsetzt und ratlos über ihr
frühes und
unerwartetes Ende. Als einzige unter den bekannten römischen
Kurtisanen hat sie
auf dem Höhepunkt ihres Wirkens, als Frau von dreißig
Jahren, Selbstmord
begangen.
Zu ihren
Verehrern zählen die intellektuellen
Koryphäen Roms,
die Spitzen des Vatikans und auch der römische Geldadel, in
vorderster Linie
Agostino Chigi. Zahlreiche Verehrer preisen sie in ihren Gedichten und
Novellen
– und zeigen sich schockiert, entsetzt und ratlos über ihr
frühes und
unerwartetes Ende. Als einzige unter den bekannten römischen
Kurtisanen hat sie
auf dem Höhepunkt ihres Wirkens, als Frau von dreißig
Jahren, Selbstmord
begangen.
Dieser Selbstmord,
dessen Ursache auf der Grundlage der
Quellen nicht eindeutig rekonstruiert werden kann, steht vermutlich im
Zusammenhang mit ihrer obsessiven Liebe zu dem schönen Lebemann
Angelo del
Bufalo und wohl auch mit der Entscheidung Agostino Chigis, ihres
reichsten
Verehrers, sie durch eine jüngere Geliebte zu ersetzen. Ihr
tragischer Tod
ruft, gerade weil er so schwer nachvollziehbar und ungewöhnlich
bleibt,
geradezu nach einem Erzähler, der ihn narrativ begründet und
damit in einen
sinnhaften Zusammenhang stellt.
Noch ›romanhafter‹
ist Agostino Chigis Verhalten als
›Privatmann‹ und Liebhaber bzw. fester Kunde Imperias: Am Ende seines business-Aufenthalts in Venedig, der gut
dokumentiert und von Felix Gilbert im einzelnen rekonstruiert wurde (in
seinem
Büchlein Venedig, der Papst und sein
Bankier, dem ich Wichtiges verdanke), entführt er Francesca
Ordeaschi, eine
noch sehr junge Frau, bringt sie nach Rom, lässt sie in einem
Kloster
›erziehen‹, um sie dann als Konkubine zu sich in seinen Palazzo
d’amore zu holen.
Das Bild rechts zeigt einen Ausschnitt aus
Sodomas großem Fresko Hochzeit
des Alexander und der Roxane, das Chigis Schlafzimmer
schmückte und für das vermutlich Francesca das Vorbild
lieferte.
Alessandro Chigi
zwischen der naiven Nymphe und der raffinierten Liebesgöttin: Hier
haben wir die
klassische Romankonstellation ein Mann zwischen zwei Frauen.
Aber
es
kommt
noch
besser:
Chigi sucht gleichzeitig nach einer Ehefrau, die
seinen
gesellschaftlichen Status erhöhen könnte, konkret: nach einer
Adelstochter. Er
glaubt sie in Margherita gefunden zu haben, der illegitimen Tochter des
Marchese von Mantua, Gianfrancesco Gonzaga. Er wirbt unermüdlich
um sie, auch
noch, als Gonzaga von ihm verlangt, er müsse seine nicht
standesgemäße Tätigkeit
als banchiere aufgeben. Selbst dazu
ist er wohl bereit. Aber die junge Dame weigert sich, ungewöhnlich
genug für
die Verhaltensweisen ihrer Zeit, den alternden Chigi zu heiraten – mit
Erfolg.
Chigi, desillusioniert, zieht schließlich seine Konsequenzen: Er
zeugt mit Francesca fünf Kinder und heiratet sie nach langem
Zögern, wohl auch auf Drängen des Papstes.
|
Wie man an den
bisherigen
Ausführungen sieht, sind wichtige Handlungsaspekte des Romans
historisch
belegt, die Protagonisten haben alle gelebt und ihre Namen behalten,
auch die
Maler und ihre Arbeit in der Villa entsprechen den Forschungen der
Kunsthistoriker, und die geschäftlichen Zusammenhänge sind
nach den Quellen
dargestellt. Die Realität liefert noch immer die beste Vorlage
für lebenspralle
Romane, man muss sie nur zu nutzen wissen.
Dennoch sah
ich mich gezwungen, in diesem Roman aus
dramaturgischen Gründen einem Prinzip untreu zu werden, das ich
gewöhnlich strikt
befolge: Statt mich streng an das Gerüst vorgegebener Zeitdaten zu
halten,
musste ich einige Datierungen leicht verschieben: Imperia stirbt im
Roman ca.
drei Jahre später als in Wirklichkeit, die Werbung um die
Gonzaga-Tochter
Margherita zog sich über einen längeren Zeitpunkt hin und
fand meist brieflich
statt, Chigi heiratete seine Francesca erst 1519. Auch war die
künstlerische
Ausschmückung der Villa 1513 (vermutlich) noch nicht
abgeschlossen.
Bei diesen
Aspekten habe ich auf die innere Logik der Handlung
Rücksicht nehmen müssen. Es galt, die Mosaiksteine der Daten
und Fakten so
miteinander zu verknüpfen, dass sie das Bild einer in sich
stimmigen,
motivierten und dramatischen Geschichte ergaben, einen Roman und nicht
nur eine
Sammlung lose miteinander verbundener Anekdoten.
Ein Porträt
des goldenen (oder
treffender: auf Pump vergoldeten) Renaissance-Zeitalters unter Leo
X.
habe ich
bereits in meinem Roman Die Tochter des
Papstes entworfen: Dort wende ich mein Augenmerk auf das Schicksal
der
Kardinals- und späteren Papstfamilie des Alessandro Farnese vor
dem Hintergrund
des italienischen und europäischen Kräftespiels, das
letztlich zur Katastrophe
des sacco di Roma führte.
In den Schwestern der
Venus geht
es mir weniger um das
Milieu des hohen Adels und der Kurie, der Condottieri und ihrer
Söldner als um
das Milieu der großen Bankherrn und Fernhandelskaufleute auf der
einen, der
Kurtisanen und der Konkubinen auf der anderen Seite. Zugleich
interessiert mich
die Variation der uralten Geschichte des Mannes, der sich nicht
zwischen zwei
Frauen entscheiden kann. Die damals wie heute immer neu zu stellende
Frage nach
den Formen und Möglichkeiten der Liebe wird im Strukturmuster
unterschiedlicher
›Wahlverwandtschaften‹ erzählt.
Obwohl
Agostino Chigi ein für damalige Verhältnisse
gigantisches Handelsimperium beherrschte, sind von seinen Briefen und
Lebenszeugnissen nur ein Bruchteil erhalten geblieben. Von mir benutzt
wurden
die erste biographische Darstellung, die sein Urgroßneffe Fabio
Chigi, der
spätere Papst Alexander VII., verfasste, die
Dokumentensammlung
von
Cugnoni
(1879)
sowie
die annotierte
Briefsammlung, die Ingrid D. Rowland 2001 herausgegeben hat (The
Correspondence
of
Agostino
Chigi).
Über
Chigis Privatleben ist wenig bekannt. Noch weniger weiß
man über Francesca Ordeaschi. Imperia, die Kaiserin
der Kurtisanen, hat ebenfalls so gut wie keine schriftlichen
Zeugnisse
hinterlassen. Ihre Zeitgenossen haben sich allerdings über sie
(oft in
fiktionaler Verkleidung) geäußert.
Ich konnte
mich, was ihr Leben und generell das Leben
römischen Kurtisanen zur Zeit der Renaissance angeht, insbesondere
auf Monica
Kurzel-Runtscheiners materialreiche und generell hervorragende
Monographie Die Töchter der Venus und auch
Georgina
Massons Kurtisanen der Renaissance stützen;
darüber hinaus liefern natürlich die Kurtisanengespräche
und der Zoppino des
Pietro
Aretino
authentisches
Material
über
das
Leben der damaligen
Venusschwestern
oder -töchter. Hinzu kommt, dass Aretinos überbordende
Sprachphantasie und
damit sein O-Ton Renaissance zu mancher Metapher und manchem Vergleich
die
Vorlage lieferte.
Zur
Darstellung Raffaels zog ich mehrere der neueren
Darstellungen heran, auch Antonio Forcellinos kürzlich in Deutsch
erschienene
Biographie (Raffael). Über Leben und
Werk Sebastiano del Piombos, den Agostino Chigi 1511 aus Venedig
mitgebracht
hatte, erfuhr ich Entscheidendes aus Kia Vahlands Darstellung Sebastiano del Piombo, ein Venezianer in Rom
sowie aus dem Ausstellungskatalog zu seinem Werk (S.d.P.,
Raffaels Grazie, Michelangelos Furor). Die einzelnen von
mir verwendeten Darstellungen und Informationen zur Villa Farnesina,
zur
römischen Renaisssance unter den Päpsten Julius II. und Leos
X., zum
wirtschaftlichen Hintergrund usw. kann ich hier aus Raumgründen
nicht aufzählen.
Wie immer bieten die vielbändigen Werke von Ferdinand Gregorovius (Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter)
und Ludwig von Pastor (Geschichte der
Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters) reichhaltiges
Material.
|
Ein
historischer
Roman
spielt
zwar
in
einer
vergangenen Epoche, ist aber in der Gegenwart entstanden. Er
stellt
eine Verbindung her zwischen dem Vergangenen, Fremdgewordenen und in
seiner
Fremdheit Faszinierenden auf der einen und dem Gegenwartsbewusstsein
auf der
anderen Seite und hilft auf diese Weise, das ›Heute‹ im Kontrast zum
›Damals‹
zu verstehen. Häufig sind vergangene Epochen uns so
unverständlich geworden,
dass wir Vermittler brauchen, die sie erneut in ihrem Alltag, im
Fühlen, Denken
und Handeln der Menschen nachvollziehbar und damit lebendig werden
lassen.
Hierin besteht eine weitere, umgekehrt gelagerte Aufgabe des
historischen
Romans: Er hilft, das ferne ›Damals‹ aus dem Verständnishorizont
der Gegenwart
zu verstehen.
Es gibt jedoch auch
vergangene Epochen, die aus dem
gegenteiligen Grund in Erstaunen versetzen: Dann nämlich, wenn wir
das Gefühl
haben, sie ähnelten der unsrigen. Die Fremdheitsspannung scheint
hier
aufgehoben zu sein. Ich verweise nur auf die immer wieder zitierte
»spätrömische Dekadenz«, die eine Parallele zur
heutigen (westlichen)
Gesellschaft darstellen soll.
Solche Vergleiche
sind allemal problematisch, weil sie viele
Parameter außer Acht lassen und zugleich dazu neigen, einen
wertenden Unterton
einfließen zu lassen. Dennoch möchte ich auf eine
historische Ähnlichkeit
verweisen, die mir während des Schreibens des Romans immer
deutlicher wurde und
die, so vermute ich, zur Faszination am Stoff beitrug.
Die Renaissance hat
in ihrem Rückgriff auf die Antike (und
in ihrer Entdeckung unbekannter Kontinente) ein neues Menschenbild
kreiert, das
erst heute seine volle Entfaltung zeigt: Begriffe wie Individualismus,
kreative
Offenheit für Neues, Loslösung von
überkommenen Wertsystemen, Hedonismus und Lust am Schönen mögen den
Rahmen geben für das, was ich meine. Denkt man an den zunehmenden
Individualismus, die weitreichenden Wertverschiebungen und zugleich an
die
›sexuelle Revolution‹ in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts,
so kann
man, zumindest was die westlichen Gesellschaften betrifft, gewisse
verwandte
Erscheinungen entdecken. Die Befreiung der Sexualität und der auch
ökonomisch
bedingte Hedonismus breiter Bevölkerungsschichten erinnert an die
höchst
verfeinerte spielerische, von allen Moralfesseln befreite Liebeskultur,
wie sie
in den höchsten Kreisen der italienischen Renaissancegesellschaft
gepflegt
wurde. Dass diese Liebeskultur zugleich und im Gegensatz zu heute
Intoleranz
und Brutalität miteinschloss, zeigen Praktiken wie der sfregio
und der trentuno und
die
nicht
seltenen
Gattinnenmorde
aus
Eifersucht.
Die Nähe oder Ferne
der
Vergangenheit ist also immer dialektisch zu sehen und in sich
widersprüchlich.
Ich glaube, dies trägt zu ihrer Faszination bei.
Die Zeit
raffinierter Erotik hielt allerdings nicht lange
vor. Der sacco di Roma vernichtete
nicht nur Menschenleben, materielle Güter und Kunstwerke, er
zeigte auch, dass
die leichtlebige Verschwendungskultur der vorhergehenden Jahrzehnte ein
Tanz
auf dem Vulkan war. Und mit der Reformation wehte der Wind
plötzlich aus einer
anderen Richtung. Die Gegenreformation, die Mitte des 16. Jahrhunderts
einsetzte und die zu einem Jahrhundert blutigster Glaubenskriege
führte, schuf
erneut eine antihedonistische, sexualfeindliche Kultur, die – mit der
einen
oder anderen Unterbrechung, insbesondere in Oberschichten-Milieus – bis
zur
Mitte des vergangenen Jahrhunderts vorherrschte. Im Verlauf dieser
Gegenreformation endete auch das goldene Zeitalter der kultivierten
Kurtisanen
– und mit ihm eine Form weiblicher Bildung und Emanzipation. Übrig
blieben
Hurerei, Hexenwahn und die verstärkte Unterdrückung der Frau.
Auf einen zweiten
Aspekt sei nur kurz hingewiesen: Agostino
Chigi gehörte, wie neben ihm Jakob Fugger und vor ihm schon der
Toskaner
Datini, zu einer kleinen Schicht von Unternehmern, die den ›Geist des
Kapitalismus‹ avant la lettre vorwegnahmen
und als global players hochkomplexe
Finanz- und Handelsunternehmen schufen. Mit Hilfe ihres rasch
erworbenen und
›sagenhaften‹ Reichtums konnten sie nicht nur die Künste
fördern, sondern auch
politisch eine wichtige Rolle spielen, die Wahl von Herrschern
beeinflussen und
den Erfolg von Feldzügen und Kriegen mitbestimmen. Kriege und die
Politik
gekrönter Hazardeure führten dann auch zu ihrem Sturz: Der sacco di Roma vernichtete endgültig das Imperium
der Chigi, und der
spanische Staatsbankrott 1557 beendete die finanzielle Vormacht der
Fugger in
Europa.
Wie sehr die
Renaissance auch in anderen Bereichen unser
Verhalten beeinflusst hat und bis in die Gegenwart fortwirkt,
mögen zwei
weitere Beispiele zeigen: Baldassare Castigliones Hofmann wurde
nicht
nur
zum
›Knigge‹
der
Renaissance, er hat nicht
nur das fortwirkende Bild des ›Gentlemans‹ geprägt, sondern wirkt
in seinem
Kult der ›coolen‹ Lässigkeit über zahlreiche
Vermittlungsstufen bis in das
Verhalten der heutigen Jugend hinein.
Und liest man, wie
Aretinos Kurtisane Nanna ihrer Tochter
Pippa Tischsitten beibringt, dann glaubt man, die traditionelle
bürgerliche
›Kinderstube‹ sei damals erfunden worden. Luthers Rülpsen und
Furzen galt
keineswegs als Zeichen oralgesättigter Zufriedenheit. Im
Gegenteil: Wer etwas
gelten wollte, unterdrückte jeden Schmatzer, gieriges
Schlürfen, vermied Reden
mit vollem Mund und ließ sein Glas nur halbvoll füllen.
Vielleicht haben uns
die Frühkapitalisten, die feinen
Kurtisanen und die lässigen Höflinge aus längst
vergangenen Tagen doch mehr zu
sagen, als wir glauben.